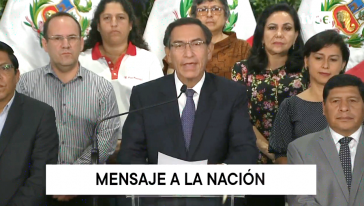Lateinamerika hat sich mittlerweile zum neuen Hotspot der Covid-19-Pandemie entwickelt. Lange lag hier das Augenmerk vor allem auf Brasilien mit seinem exzentrischen, ultrarechten Präsidenten Jair Bolsonaro, der durch sein zynisches Leugnen des Ernstes der Lage und seiner Wissenschaftsfeindlichkeit auf sich aufmerksam machte. Da scheint es in der Folge nur logisch, dass dieses unverantwortliche Handeln dazu geführt hat, dass Brasilien nun nach den USA die zweitmeisten bestätigten SARS-CoV-2-Infektionen weltweit zu verzeichnen hat.
Gar nicht in dieses Bild will da die Lage im benachbarten Peru passen – aktuell nach Brasilien auf Platz zwei was die bestätigten Covid-19-Fälle in der Region angeht. Denn das Land galt in der Pandemie anfangs noch als Musterschüler. Kein anderes Land hat in Lateinamerika so viele Tests durchgeführt wie der Andenstaat, dementsprechend wurden dann natürlich auch mehr Fälle festgestellt. Aber diese Erklärung reicht nicht aus, das Scheitern der umfangreichen Bemühungen zur Einhegung des Virus zu erklären. Keine Statistik kann die derzeitige Überbelastung des Gesundheitssystems und die über 4.000 bestätigten Corona-Toten wegrechnen. Dementsprechend ergeben sich Fragen.
Seit Peru aufgrund seiner Infektionszahlen verstärkt in den internationalen Fokus geraten ist, sich das Narrativ der missglückten harten Maßnahmen also nicht mit dem anderswo erfolgreichen "Flattening the Curve" deckt, häuften sich die Berichte über das "peruanische Paradox".
Rückblick: Am 15. März verkündet Präsident Martín Vizcarra überraschend einen nationalen Lockdown, nachdem erst 71 Fälle im Land registriert worden waren. Über Nacht werden die Grenzen geschlossen, der nationale Bus- und Flugverkehr wird eingestellt und niemand darf mehr raus – außer zum Lebensmittelkauf, und dann auch nur alleine. Zu dieser Zeit gibt es in Europa bereits Tausende Fälle, doch dort werden Maßnahmen erst viel zögerlicher ergriffen, obwohl die Krankheit dort schon weiter fortgeschritten ist. Nun fast drei Monate später kehrt Europa langsam wieder zur Normalität zurück, während Peru die 170.000 Infektionen überschritten hat (Stand 3. Juni, Zahlen der WHO).
Wie konnte das passieren? Zahlreiche Analysen in der internationalen Presse und von peruanischen Wissenschaftlern nennen zwei Hauptgründe: prekäre Lebensbedingungen und informelle Arbeit.
Während bereits in Europa Kommentatoren früh auf den Unterschied zwischen einer Quarantäne in einem Ein-Familien-Haus mit Garten und einer beengten Stadtwohnung hinwiesen, sind diese Disparitäten in Peru und benachbarten Ländern um einiges extremer: Nicht nur die ganz armen Menschen leben hier mit vielen Generationen unter einem Dach, sodass "Social Distancing" unmöglich ist. Hygiene-Regeln können ohne einen Wasseranschluss schlecht eingehalten werden und den haben in Peru nur etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung.
Nur vereinzelte Großeinkäufe im Supermarkt sind schwierig, wenn lediglich 49 Prozent der Menschen einen Kühlschrank besitzen. Und sicheres Einkaufen im weitläufigen Supermarkt funktioniert nicht, wenn nur die überfüllte Markthalle preisgünstige Lebensmittel anbietet. Messungen von Gesundheitsvertretern ergaben hier, dass teilweise bis zu 80 Prozent der Verkäufer infiziert waren.
Um sich das Essen überhaupt leisten zu können sind viele Familien auf die Bonuszahlungen des Staates angewiesen. Insgesamt 200 Euro pro bedürftiger Familie. Doch da nur 38 Prozent aller Peruaner ein Bankkonto besitzen, mussten viele Menschen über Stunden hinweg dicht gedrängt in der Schlange vor der Bankfiliale warten, damit sie ihren Bonus ausbezahlt bekamen.
Der zweite große Unterschied zu den reichen Industriestaaten sind die Arbeitsverhältnisse. In Peru sind 70 Prozent der Menschen "informell" beschäftigt. Das heißt sie arbeiten ohne Vertrag und dementsprechend ohne jedweden sozialen oder rechtlichen Schutz – der auch bei formellen Jobs sehr dürftig ausfällt. Der Lockdown bedeutete für sie die sofortige Arbeitslosigkeit. Dazu kommen hunderttausende neue Arbeitslose, bislang formell angestellt. Trotz staatlichem Bonus bangen viele ums Existenzminimum. Leute, die nicht in den öffentlichen Registern zu finden sind und Ausländer – hier insbesondere die 800.000 venezolanischen Flüchtlinge im Land – erhalten gar nichts.
Und so werden die Straßen im dritten Monat der Quarantäne immer voller: Fliegende Händler, Bettler, sie alle gehen wieder auf die Straße um zu arbeiten und sind dabei nicht nur dem Virus, sondern auch polizeilicher Repression ausgesetzt. Auch sämtliche Hausangestellte verrichten wieder ihren Dienst und pendeln in dicht besetzten Bussen.
Konservative Stimmen nennen die "Unverantwortlichkeit" der Peruaner als Hauptursache für das Scheitern der Maßnahmen. Präsident Martín Vizcarra selbst, der seinem Land in zahlreichen Ansprachen Trost spendete und Durchhaltevermögen predigte, sagte: "Der Egoismus hat uns in diese Situation gebracht".
Die Corona-Krise wird zum Katalysator für sämtliche strukturelle Probleme Perus: Das öffentliche Gesundheitssystem war eines der schlechtesten auf einem Subkontinent, der nicht gerade für seinen guten Zugang zu medizinischer Infrastruktur bekannt ist. Die für Lateinamerika typische Zwei-Klassen-Medizin offenbart nun endgültig ihre Abgründe. Und auch die Infrastruktur im Bildungswesen zeigt jetzt, wie schwierig die Fernbildung sein kann, wenn schon in normalen Zeiten prekäre Zustände herrschten. Wie in der Medizin entscheidet ebenso in der Bildung der Geldbeutel über die Qualität des Angebots und nun auch grundsätzlich darüber, ob die Bildung fortgesetzt werden kann.
Die Informalität wird jetzt, aber auch in der Zeit nach der Pandemie ein großes Problem bleiben. Menschen, die in diesem Sektor arbeiten, sind extrem verwundbar. Bislang versuchte man das Problem durch den systematischen Abbau von Arbeitsrechten zu lösen mit der Hoffnung, dass so mehr Arbeitnehmer formell angestellt werden – ein Reinfall, wie es sich erwies. Die bestehenden sozialen Sicherungssysteme und das Rentensystem sind prekär und größtenteils in privater Hand. Spätestens jetzt wird klar: Das Modell ist nicht krisenfest.
Und schließlich: Die soziale Ungleichheit. Hier geht es Peru relativ besser als seinen Nachbarn Kolumbien oder Chile. Das ist zum Teil heute noch der umfangreichen Agrarreform der 1960er-Jahre geschuldet. Dennoch sind bis heute eine Hand voll Superreiche im Besitz so gut wie aller großen Unternehmen des Andenstaates. Dabei handelt es sich in der Regel um Monopole. Bislang erwiesen sich die staatlichen Institutionen als zu schwach, um diese zu regulieren.
Aber die Pandemie bietet auch Chancen, die drei Problemkomplexe Infrastruktur, Informalität und Ungleichheit anzugehen: Viele Experten in Peru haben schon lange Reformvorschläge und formulieren sie auch jetzt. Einige davon sind mittlerweile auch im politischen Mainstream angekommen. In den letzten Monaten wurde die Zahl der landesweit verfügbaren Krankenhaus- und Intensiv-Betten massiv aufgestockt. Im Bildungssektor möchte die Regierung alle Kinder im Schulalter mit Tablet-Computern versorgen. Obschon es sich hier um Notmaßnahmen handelt, könnten weitere Reformen folgen.
Auch wirtschaftsliberale Denker wie der bekannte Entwicklungsökonom Hernando de Soto sehen in der hohen Rate der Informalität Perus ein Problem und schlagen pragmatische Erneuerungen vor. Die Regierung kündigte zudem bereits an, gegen die mächtigen privaten Pensionsfonds vorzugehen und das System zu reformieren. Doch ob wirkliche Verbesserungen der Arbeitsbedingungen oder nicht eher eine weitere Prekarisierung die Folge der Krise sein werden, bleibt ungewiss und könnte Thema der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr werden.
Was die Ungleichheit angeht, wird hier der Ruf nach einer Reichtumssteuer immer lauter. Das ist nicht einmal nur ein linkes Projekt – mittlerweile fordern selbst orthodoxe Ökonomen des IWF oder der Financial Times eine Beteiligung der "One Percent" bei der Finanzierung der Krise.
Die Frage bleibt: Wird die peruanische Politik mutige Schritte gehen können, um die nötigen Reformen umzusetzen, die die Corona-Krise nun in den Fokus gerückt hat? Kolumnistin Gabriela Wiener konstatiert: "Der große Fehler der peruanischen Regierung war es, das eigene Land nicht lesen oder verstehen zu können." Vielleicht wäre das zu lernen der erste notwendige Schritt.