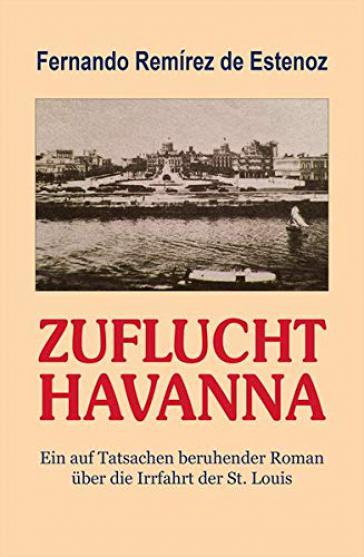Am 13. Mai 1939 verließen 937 meist jüdische Flüchtlinge mit dem Passagierschiff St. Luis der Hamburg-Amerika Linie, Hapag, Nazi-Deutschland. Von Hamburg aus steuerte das Schiff den Hafen von Havanna an. Dann der Schock: Entgegen aller Planungen verwehrte man ihnen, an Land zu gehen. Und dies, obwohl jede Person an Bord die entsprechende Berechtigung hatte, eine so genannte Landeerlaubnis, für die sie jeweils mindestens 150 US-Dollar gezahlt hatten. Fast alle von ihnen hatten ein Visum für die Vereinigten Staaten beantragt und planten, nur so lange auf der Insel zu bleiben, bis sie in die USA einreisen konnten.
Doch acht Tage bevor die St. Luis von Hamburg aus nach Kuba ablegte, hob der damalige kubanische Präsident Federico Laredo Bru die Landeerlaubnis per Dekret auf. Um nach Kuba einzureisen, wäre es von nun an erforderlich gewesen, eine Genehmigung des Außenministeriums und eine weitere des Arbeitsministeriums sowie die Zahlung von 500 US-Dollar vorzuweisen. Keiner der Passagiere der St Luis wusste vom Inkrafttreten dieser Maßnahme, bis sie den Hafen von Havanna erreichten. Und dann war zu spät. Sie mussten ihre Rückreise nach Europa antreten. Letztlich überlebten gut zwei Drittel der Passagiere. Sie konnten später ihre Version dieser Tragödie erzählen.
Nur 28 der 937 Passagiere aus St. Louis konnten am 27. Mai 1939 in Havanna an Land gehen. Nur 22 konnten die neuen Dokumente vorweisen, die für das Ausschiffen erforderlich waren. Ein jüdischer Passagier beging an Bord einen Suizidversuch und musste in ein Krankenhaus in Havanna eingeliefert werden. Über sein Schicksal ist nichts weiter bekannt.
Kapitän Schröder, selbst Mitglied der NSDAP, steuert die St. Louis schließlich nach Antwerpen. Von dort aus werden die Passagiere von verschiedenen Ländern aufgenommen. Die meisten überleben den 2. Weltkrieg. 254 Passagieren der "St. Louis" aber gelingt das nicht. Sie werden Opfer des Holocaust. Schröder wurde in Israel posthum in den Kreis der "Gerechten unter den Völkern" aufgenommen.
Der ehemalige kubanische Politiker und Diplomat Fernando Remírez de Estenoz nutzt die Liebesgeschichte zwischen einem kubanischen Jungen und einer jüdischen Österreicherin als roten Faden, um historisch akkurat die Ereignisse rund um die Überfahrt des deutschen Kreuzfahrtschiffes zu erzählen. Die Propaganda des Dritten Reiches, seine Geheimdienstnetze auf der ganzen Welt, Korruption, die Mafia, die politische Instabilität, die jüdischen Gemeinschaften, die Manipulation der Presse, Wien, Berlin, Havanna, Washington und New York sind die Szenarien dieses Romans, der die tragische Geschichte der St. Louis nach 80 Jahren wieder erlebbar macht.
Amerika21 dokumentiert Auszüge aus dem Buch.
Am Tag ihrer Abreise wachte Rebeca zeitig auf; der Morgen dämmerte noch nicht, und das ganze Zimmer war in das ungewöhnliche Halbdunkel dieser frühen Stunde getaucht. Sie verspürte das eigentümliche Gefühl eines Menschen, der zum ersten Mal in einer fremden Wohnung die Augen aufschlägt. Sie schaltete die kleine Nachttischlampe ein und sah auf die Uhr. Es war kurz nach fünf Uhr, zu früh um aufzustehen, sie würde noch zwei Stunden schlafen können, denn sie brauchte sich nur anzuziehen und zu frühstücken. Die St. Louis sollte an diesem Tag, dem 13. Mai, um acht Uhr abends ablegen, und wenn sie irgendwann am Vormittag an der Mole war, hatte sie mehr als genug Zeit, an Bord zu gehen. Sie versuchte, noch einmal einzuschlafen, machte es sich, so gut es ging, in dem engen Bett bequem, doch der Schlaf wollte nicht kommen. Sie rief sich den Vortag ins Gedächtnis und kam zu dem Schluss, dass alles gut gelaufen war, ja, besser als erwartet. Frau Fischer war sehr liebenswürdig gewesen, die Unterkunft war bequem und mit allem Notwendigen ausgestattet, und vor allem war sie hier sicher, ohne die Ungewissheiten und Ängste, die die Juden an unbekannten Orten verspürten. Nach dem Essen hatte sie ausgiebig Mittagsschlaf gehalten, sie hatte ein wenig gelesen,sich dann umgezogen und war zum Abendessen hinuntergegangen. Wieder sprachen die Gastgeberinnen ausführlich über die zahlreichen Feiern und Abendessen, zu denen sie in vergangenen Zeiten, als die Fischers noch zur Hamburger Oberschicht gehörten, eingeladen hatten. Die beiden Frauen hatten sich den ganzen Abend über recht redselig gezeigt; offenkundig genossen sie die Gelegenheit, eine neue Gesprächspartnerin zu haben, die ihren Bemerkungen und Anekdoten aufmerksam lauschte, denn für gewöhnlich aßen sie allein, und es vergingen Wochen ohne einen Besuch. Das Menü war ausgezeichnet. Serviert wurde es auf auserlesenem Geschirr und mit allem, was ein Galadiner ausmacht. Nach dem Dessert nahm man sich Zeit für eine Tasse Kaffee und sogar für ein Gläschen Portwein, um den Gast zu verabschieden. Im gemütlichen Salon, in dem überall Fotos der Vorfahren und der Eltern hingen, musste Rebeca eine Welle von Fragen über ihre Familie, die Vereinigten Staaten und New York über sich ergehen lassen, bis Frau Fischer sie feinfühlig entließ, damit sie sich ausruhen konnte.
Sie war sofort eingeschlafen, doch jetzt konnte sie keinen Schlaf finden; zweifellos war es die Anspannung vor der Abreise. Sie versuchte, ihren Gedanken eine andere Richtung zu geben, um noch etwas schlummern zu können. Sie dachte an José Antonio und an ihr baldiges Wiedersehen und verspürte den Wunsch, ihn an ihrer Seite zu haben und ihn zu umarmen. Obschon der Gedanke daran angenehm war, wollte sie ihn nicht weiter verfolgen. Unwillkürlich kamen ihr die Geschehnisse und Erlebnisse der beiden letzten Jahre in den Sinn: ihre Ankunft in Österreich, die Krankheit ihrer Mutter und die Besetzung durch die Nazis. Sie hatte ungeheuren Schwierigkeiten getrotzt und überlebt; sie wunderte sich selbst darüber, dass sie in der Lage gewesen war, sich all diesen Problemen zu stellen und heil aus allem herauszukommen. Das, was ihr als unmöglich erschienen war, stand jetzt bevor: die Ausreise aus dem Dritten Reich. Allein Elisabeth fehlte ihr. Ihr Tod war ein schwerer Schlag gewesen, obwohl es sie tröstete, dass sie nach Wien zurückgekehrt war, als sie gebraucht wurde, und der Mutter in den schwierigsten Momenten beigestanden hatte. Diese Entscheidung, so sagte sie sich, würde sie nie bereuen. Wieder öffnete sie die Augen; das schwache Licht der frühen Morgendämmerung erhellte allmählich das Zimmer. Sie mochte nicht weiter wach im Bett liegen, und noch weniger wollte sie sich mit den Gedanken an die jüngste Vergangenheit herumplagen. An Schlaf war nicht mehr zu denken. Sie schob ihre Schlaflosigkeit auf den langen Mittagsschlaf vom Vortag nach der beschwerlichen Bahnfahrt, auf der sie nur hin und wieder kurz eingenickt war. Sie wollte sich ausgeruht auf die Abreise vorbereiten. Vor allem musste sie auf etwas Unvorhergesehenes oder ein im letzten Moment auftretendes Hindernis gefasst sein. Nie wusste man, was den Nazi-Beamten einfallen konnte, und in Wien hatte sie von dramatischen Geschichten gehört, dass einem die Ausreise verweigert wurde, weil ein Dokument oder auch nur eine Unterschrift oder ein Stempel fehlten. Ihr war nicht bekannt, wie das Einschiffen im Einzelnen ablaufen würde, aber mit Sicherheit würde es nicht leicht und auch nicht angenehm sein. Das Auslaufen eines Kreuzfahrtschiffes voller Juden wäre bestimmt kein fröhliches Ereignis.
Angesichts des Morgenlichts entschloss sie sich, nicht länger mit dem Bett zu kämpfen, und sie stand auf, um sich dem vor dem Ausgehen üblichen längeren weiblichen Ritual hinzugeben. Und übrigens war dies ein besonderer Tag. Sie wollte einen möglichst eleganten Eindruck machen und ihre jugendliche Schönheit zur Schau stellen, auch als Waffe, die sie bei eventuell auftretenden Problemen nutzen konnte. Es war nicht das erste Mal, dass sie dieses Mittel einsetzte, und es hatte stets funktioniert. Sie suchte die Kleidung heraus, die sie für diesen Tag gewählt hatte, ihr bestes frühlinghaftes Kleid, einen kleinen Hut und die besterhaltenen Schuhe. In aller Ruhe kleidete sie sich an, kämmte und schminkte sich wie für ganz große Anlässe. Als sie fertig war und sich in dem kleinen Spiegel betrachtete, hatte sie nicht das Gefühl, sich zu gefallen. Das war nicht der Glanz, den sie erwartet hatte. Aber das war schon oft so gewesen, vor allem dann, wenn sie wirklich schön aussehen wollte. Die Unzufriedenheit mit ihrem Äußeren war einer der seltenen Momente, in denen sie ein Zeichen von Schwäche erkennen ließ. Auch wenn sie aus einem wichtigen Anlass das Haus verließ, zog sie sich mehrmals um; sie wollte perfekt aussehen.
Das Frühstück war reichhaltig, wie es sich für eine gute deutsche Mahlzeit gehörte, und diesmal hielten sich die Damen in ihrer Konversation zurück und beschränkten sich auf Erkundigungen über das Kreuzfahrtschiff. Als Rebeca nach der Bezahlung für ihren Aufenthalt fragte, gab Frau Fischer zurück, sie wünsche einzig und allein, dass sie sicher an ihr Ziel gelange. Punkt neun Uhr fuhr ein Auto vor, an dessen Steuer der alte Chauffeur der Familie saß, und Rebeca verabschiedete sich von den Gastgeberinnen. Die ältere Dame mit der sanften, ruhigen Stimme sagte, sie habe sich gefreut, die Bekanntschaft gemacht zu haben, sie möge bei der Überfahrt gut auf sich aufpassen, und sie wünsche ihr eine baldige Heirat und viele Kinder. Dann küsste sie sie auf beide Wangen und wünschte ihr eine gute Reise.
Frau Fischer begleitete sie bis in den Garten, während das Dienstmädchen die Koffer im Auto verstaute. "Ich wünsche Ihnen eine glückliche Reise und dass Sie bald wieder bei den Ihren sind."
"Vielen Dank für alles. Ich hoffe, wir sehen uns eines Tages wieder."
"Das hoffe ich auch. Wir werden hier sein. Hier in Hamburg werden Sie immer willkommen sein."
"Ich weiß, und ich werde es nicht vergessen", gab Rebeca zurück und umarmte ihre Gastgeberin, die diese Geste zwar etwas überraschte, gegen die sie sich aber nicht wehrte. Sie stieg ins Auto mit dem Gedanken, dass es trotz allem in der Welt gütige Menschen gab. Sie fragte sich, welches Schicksal Frau Fischer und ihre Mutter wohl erwartete.
Als sie am Kai 76 des riesigen Hamburger Hafens anlangte, wartete dort schon eine unübersehbare Menschenschlange. Alle standen ordentlich in einer Reihe und harrten darauf, dass sie aufgerufen wurden, um ihre Reisepapiere vorzuzeigen und an Bord zu gehen. Auffällig waren die vielen Frauen und Kinder. Wie unterschiedlich die Leute doch waren: Da waren teuer und elegant gekleidete Damen, auch ein Paar in festlicher Kleidung, als würden sie in die Wiener Oper gehen. Andere standen da in abgetragenen Sachen, mehrere in bemitleidenswertem Zustand, schlecht angezogen und eines dringenden Bades bedürftig. Doch eins war allen gemeinsam: der ängstliche Gesichtsausdruck. Überall stand Polizei herum, und ein ganzes Kontingent von Männern, die sich wie Agenten der Gestapo benahmen, rief ein ironisches Lächeln auf Rebecas Gesicht hervor. Die aufwendigen Sicherheitsvorkehrungen waren absurd. Die Passagiere würden sich garantiert wohl verhalten. Sie wollten lediglich so rasch wie möglich fort. Endlich war sie an der Reihe; sie betrat die Wartehalle und wandte sich zum Abfertigungsschalter. Sie fühlte Blicke auf sich gerichtet und dachte, sie würde keinen so schlechten Eindruck machen, wie sie geglaubt hatte. Es enttäuschte sie, dass ihr der sie abfertigende HAPAG-Beamte kein Lächeln schenkte und eilfertig, aber offensichtlich schlecht gelaunt, mit der Kontrolle begann. Die Ausreisekontrolle war streng, und der Beamte prüfte Rebecas Pass bis ins Kleinste. Schlimmer noch war allerdings die Zollkontrolle, bei der die Beamten ihre beiden Koffer leerten und jedes Kleidungsstück peinlich genau untersuchten. Rebeca war darauf vorbereitet, und die Inspektoren ärgerten sich, nichts Verbotenes gefunden zu haben, auch nicht eine einzige Mark mehr als die zehn erlaubten, die jeder Passagier mit sich führen durfte. Nach der Durchsicht ihrer Habseligkeiten machte sich Rebeca daran, alle Sachen wieder mühevoll in den Koffern zu verstauen. Ein Angestellter befahl ihr, sich zu beeilen. Einen Moment lang war sie nahe daran, ihm zu antworten, dass die Schuld für die Verzögerung nicht bei ihr lag, doch sie behielt es lieber für sich. In diesem Augenblick fielen einem älteren Ehepaar, das gerade am Nachbartisch inspiziert wurde, mehrere Bücher auf den Boden, und ein Gestapo-Beamter begann die betretenen Passagiere zu beschimpfen. Rebeca half ihnen, die Bücher aufzusammeln und reichte sie der Frau, die sich leise bedankte.
"Was sind das für Bücher?« fragte einer der Inspektoren und nahm eins der heruntergefallenen in die Hand. Nach längerem Schweigen antwortete der Alte: "Es ist Literatur, einer der besten Romane in deutscher Sprache."
"Das habe ich nicht gefragt. Sind es verbotene Bücher oder nicht?" In diesem Moment trat ein anderer Mann, der wohl der Chef der Gruppe und in Zivil gekleidet war, hinzu, nahm dem Inspektor das Buch aus der Hand, schaute kurz darauf und reichte es der Frau zurück. "Gehen Sie weiter und verschwenden Sie nicht noch mehr Zeit. Wir haben noch viel zu kontrollieren."
Das Paar packte die Bücher in den Koffer und ging rasch weiter. Auch Rebeca wandte sich dem Einstieg zu, doch der Vorfall beschäftigte sie weiter. Der alte Mann hatte nicht übertrieben: Der Zauberberg gehörte zum Besten der deutschen Literatur, und delikat daran war, dass sein Verfasser tatsächlich auf dem Index stand. Die schlimmste Zeit, die der Bücherverbrennung, lag zwar schon einige Zeit zurück, doch die Verbote bestanden noch immer. Trotzdem hatte der Beamte den Roman nicht konfisziert. Was war geschehen? Sie würde es nie erfahren, möglicherweise bildete der Gestapo-Mann die Ausnahme von der Regel. In Wien war das Gerücht umgegangen, dass Freud dank der Hilfe eines Nazi-Beamten entkommen konnte.
Beim Verlassen der Abfertigungshalle schlug ihr der Geruch des Hafens entgegen; und eine Blaskapelle verabschiedete mit ihrer Musik den Passagierdampfer, wie es bei einem Luxuskreuzer üblich war. Die St. Louis bot einen umwerfenden Anblick. Sie war gigantisch, hatte fünf Stockwerke und mehrere Decks, war weiß gestrichen und hatte gewaltige Schornsteine. Allein die riesige Nazi-Fahne am Heck schockierte sie. Niemand half ihr mit dem Gepäck. Also versuchte sie, das Gewicht ihrer Koffer zu ignorieren, und begab sich zu der entsprechenden Rampe. Urplötzlich tauchte ein Fotograf vor ihr auf, und ohne sie um Erlaubnis zu bitten, richtete er den Apparat auf sie. Rebeca schenkte ihm ein Lächeln, und da ließ der junge Mann die Kamera sinken, ohne auf den Auslöser zu drücken, und schaute sie an, bis hinter ihr ein ungekämmter, schweißüberströmter Mann herankam, der einen alten Schrankkoffer schleppte und sofort fotografiert wurde. Rebeca zuckte mit den Achseln, und in diesem Moment vernahm sie ein Lied, vertraut vorkam, und als sie die Melodie erkannte, blieb sie stehen. Die Kapelle intonierte "Wien, du Stadt meiner Träume", und sofort stieg die Erinnerung an ihre Stadt in ihr auf. Sie setzte ihren Weg fort und wunderte sich über die Zufälle im Leben. Sollte das Lied ein gutes Omen sein? Sie stieg die Gangway nach oben, bis ein baumlanger Seemann auf sie zutrat und ihr mit Leichtigkeit die schweren Koffer abnahm. "Willkommen auf der St. Louis, mein Fräulein, wir freuen uns, Sie an Bord zu haben." So ganz anders war das Auftreten dieses Mannes, dass Rebeca völlig überrascht war und nur ein schüchternes Danke stammeln konnte. Später bedauerte sie, dass sie dem ersten freundlichen Deutschen seit langer Zeit ihren Dank nicht deutlicher zum Ausdruck gebracht hatte.
(Kap. 4, S. 64-69)
Achttausend Kilometer weit, in der Karibik, brach der Morgen an. Am Tag zuvor hatte in Havanna die größte antisemitische Kundgebung in der Geschichte des Landes und des ganzen Kontinents stattgefunden. Mehr als 40 000 Kubaner waren dem Aufruf des Führers der Partido Auténtico, des alten und voraussichtlich zukünftigen Präsidenten Dr. Grau San Marín, gefolgt, um gegen die bevorstehende vermeintliche Judenschwemme in Kuba zu protestieren. Die Kundgebung war der Höhepunkt einer heftigen antisemitischen Pressekampagne und stellte einen Wandel ohnegleichen im Umgang mit den bislang nach Kuba eingewanderten Juden und anderen Migrantengruppen dar. Die Insel verzeichnete eine der höchsten Einwanderungsraten in der Welt, vergleichbar nur mit den Vereinigten Staaten, Kanada und Argentinien. Allein in Havanna war ein Viertel der Einwohner in einem anderen Land geboren, die meisten kamen aus Spanien, aber viele waren auch aus China, den karibischen Inseln, dem Nahen Osten und aus allen Ecken Europas gekommen.
************
(Kapitel 1, S. 12-13)
************
Tony erreichte sein Haus in der Straße San Lázaro, als die Sonnenhitze dem morgendlichen Havanna zuzusetzen begann; er hatte seinen ärztlichen Dienst in der Rettungsstation beendet, wo er die ganze Nacht mit Notfällen beschäftigt gewesen war, unter anderem mit einem Verrückten, dem eine seiner Nutten in einem Anfall von Hysterie ein Messer in den Hintern gejagt hatte. Nach so vielen Jahren des Studiums und so vielen Opfern, die er erbracht hatte, um sein Medizinstudium abzuschließen, hatte er lediglich eine miserabel bezahlte Aushilfsstelle ergattern können. Die Gewerkschaft der Filmvorführer hatte ihn zwar offiziell zu ihrem Arzt berufen, aber die Ernennung war eher symbolisch als alles andere; seine alten Freunde kamen niemals, um sich von ihm behandeln zu lassen – wahrscheinlich eher aus Geldmangel als aus gesundheitlichen Gründen.
Als er die Tür öffnete, hörte er seine Mutter von der Küche her, von wo er auch die Stimme des Chinesen Chan Li Po vernahm, des besten Detektivs in Kuba, der Tag für Tag im beliebtesten Rundfunkprogramm ein Rätsel entwirrte und einen bösen Verbrecher aufgriff.
"Bist du es, José Antonio?" Wer sonst, fragte sich Tony.
"Ja, ich bin’s, Mama. Wie geht es dir?" gab er zurück, betrat die Küche und drückte Eloísa einen Kuss auf.
"Gut, mein Sohn, gut. Wie war es auf der Station?"
"Schrecklich, kam keine Minute zur Ruhe. Gibt es Kaffee?"
"Willst du dich nicht erst einmal hinlegen?"
"Ja, wenn ich mich geduscht und gefrühstückt habe, aber jetzt ist mir nach einer Tasse Kaffee."
"Wenn du schlafen willst, solltest du keinen Kaffee trinken."
"Mama, ich brauche einen Kaffee. Wenn ich so kaputt bin, kann ich nicht einschlafen."
"Gut, du musst es ja wissen. Heute bekommst du einen. Da ist ein Telegramm für dich."
"Ein Telegramm? Von wem?"
"Weiß nicht, ich hab es nicht aufgemacht. Es liegt auf dem Tisch in deinem Zimmer."
José Antonio wandte sich seiner winzigen Kammer zu, wo er den Umschlag sah. Das Telegramm bestand lediglich aus zwei Zeilen in Englisch, ausreichend, um ihm den Atem stocken zu lassen. "José Antonio, Mutter verstorben stop Reise mit Kreuzfahrtschiff St. Louis von Hamburg stop Ankunft Havanna erste Juniwoche stop Würde mich freuen, dich zu sehen stop Rebeca."
(Kapitel 1, S. 17-18)
************
Während Rebecas Zug die strengen Fahrpläne der deutschen Reichsbahn pünktlich einhielt, konnte José Antonio in Havanna trotz der schlimmen Nacht und der angestauten Müdigkeit nicht einschlafen. Seit er das Telegramm gelesen hatte, drehte sich alles in seinem Kopf. Zwei Jahre nach dem ungemütlichen Abschied hatte er die Österreicherin beinahe vergessen und alle Pläne, ihr noch einmal zu begegnen, aufgegeben.
( 2. Kapitel, S. 35)
************
Die Mittagshitze lastete schwer auf dem Präsidenten der Republik Kuba. Er schwitzte trotz des Ventilators und obwohl er sich in Hemdsärmeln befand. Er wies einen Mitarbeiter an, das Fenster zu öffnen, doch statt der frischen Meeresbrise drang eine Lichtflut in das geräumige Büro. In den Sommermonaten waren die Stunden nach dem Mittagessen im Präsidentenpalast, dem großartigen Bauwerk in der Avenida de las Misiones, kaum auszuhalten. Er war um seine gewohnte Siesta gebracht worden, was seine Übellaunigkeit noch verstärkte. Jetzt bereute er, dass er die Besprechung mit Sánchez für diese Uhrzeit angesetzt hatte. Außerdem würde der sicher kommen, um ihn um einen Gefallen zu bitten. So war es immer….Sánchez war ein Freund; in alten Zeiten hatten sie zusammengearbeitet. Sein Einfluss reichte in mehrere Bereiche der Politik hinein, und bald würde Laredo Brú jedwede mögliche Hilfe gebrauchen können. Bei den nächsten Wahlen wollte er zum Präsidenten gewählt werden und damit seine politische Laufbahn krönen,...und nicht mehr nur zufällig ein Präsident sein, der nach dem Willen Batistas an die Macht gelangt war....
Der Repräsentant des Staates hörte sich geduldig die üblichen Begrüßungsformeln und die lange Tirade gegen den Generaldirektor für Einwanderung an. Allmählich wehte eine leichte Brise durch das Fenster herein, und sein Blick fiel auf ein Kreuzfahrtschiff, das in die Bucht einlief, während sich Sánchez über die respektlose Reaktion von Benítez beschwerte und mit dem für die Kubaner typischen Ungestüm darlegte, warum man es dem selbstgefälligen Beamten zeigen sollte.
"Was schlägst du vor?" fragte Laredo Brú kurz angebunden.
"Ich denke, Benítez stellt deine Autorität infrage, und du müsstest ihn von diesem Posten abziehen...."
(5.Kapitel, S. 86,89)
************
Hakim war missmutig, sehr missmutig. Tags zuvor hatte er an einer Zusammenkunft mit einem hohen Repräsentanten der Authentischen Partei teilgenommen; der Mann wollte unbedingt über die Frage der deutschen Flüchtlinge diskutieren. Hakim fiel aus allen Wolken, als dieser Politisierer, einer der Organisatoren des Meetings gegen die Einreise weiterer Juden in Kuba, fünfzigtausend Pesos als Entschädigung verlangte, damit seine Partei die antisemitischen Angriffe einstellte. Als er das hörte, musste er sich sehr beherrschen, um seinen Gesprächspartner nicht zum Teufel zu wünschen. Mit der größtmöglichen Kaltschnäuzigkeit erwiderte er, er würde die anderen Leitungsmitglieder konsultieren, hielt aber mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg; er sei gegen jegliche Entschädigung für die Einstellung einer schändlichen und unbegründeten Kampagne. Außerdem seien solche Zahlungen in seiner Organisation unüblich, und ihr fehle auch das Geld......
(12. Kapitel, S. 211 – 212)
Fern aller judenfeindlichen Reportagen und Artikel, die vom Propagandaministerium mit den umfangreichen Ressourcen des ideologischen Apparats des Dritten Reiches verbreitet wurden, setzten die St Louis und ihre Passagiere ihre Reise über den Atlantik mit einer Geschwindigkeit von sechzehn Knoten fort. Alle Pressemedien, die deutschen Botschaften, die Abwehr, die Nazi-Gruppierungen im Ausland wurden angewiesen, die Fotos der Passagiere beim Anlegen und die Falschmeldungen über die aus Europa fliehenden Juden in alle Welt zu senden. Die Juden seien als menschlicher Abschaum, als Diebe, die mit dem geraubten Vermögen entwischen, als unheilbar Kranke, als todkranke Greise und junge Straftäter darzustellen. Der einzige Ort auf dem Planeten, an dem man von der Kampagne nichts mitbekam, war das Kreuzfahrtschiff. Der Kapitän hatte entschieden, die zahlreichen per Funk eintreffenden Nachrichten nicht weiterzugeben, und die Passagiere erfuhren nichts von dem Drama, deren Hauptprotagonisten sie selber waren. Keiner der Reisenden war sich der bevorstehenden Gefahren bewusst; sie fühlten sich sicher und genossen mit großer Zuversicht die Überfahrt und ein Klima, das sich von Tag zu Tag erwärmte.
(16. Kapitel – Beginn – S. 268)
© NORA Verlagsgemeinschaft (2019)
Zuflucht Havanna. Ein auf Tatsachen beruhender Roman über die Irrfahrt der St. Louis
Von Fernando Remírez de Estenoz (Autor). Herausgegeben von Camilla Seidelbach. Übersetzung aus dem Spanischen: Manfred Schmitz